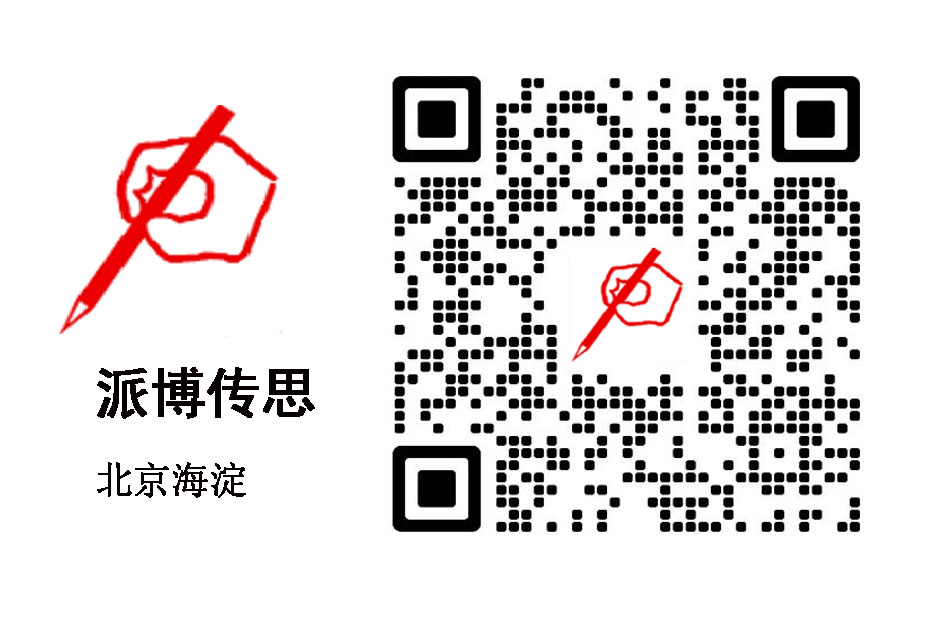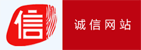| 书目名称 | Lenkungshandbuch |
| 副标题 | Lenksysteme, Lenkgef |
| 编辑 | Peter Pfeffer,Manfred Harrer |
| 视频video | http://file.papertrans.cn/585/584959/584959.mp4 |
| 概述 | Aktuelles Fachbuch zur Entwicklung von Lenksystemen in Pkw und Lkw mit zahlreichen Ausführungen und mit heutiger Elektronik |
| 丛书名称 | ATZ/MTZ-Fachbuch |
| 图书封面 | 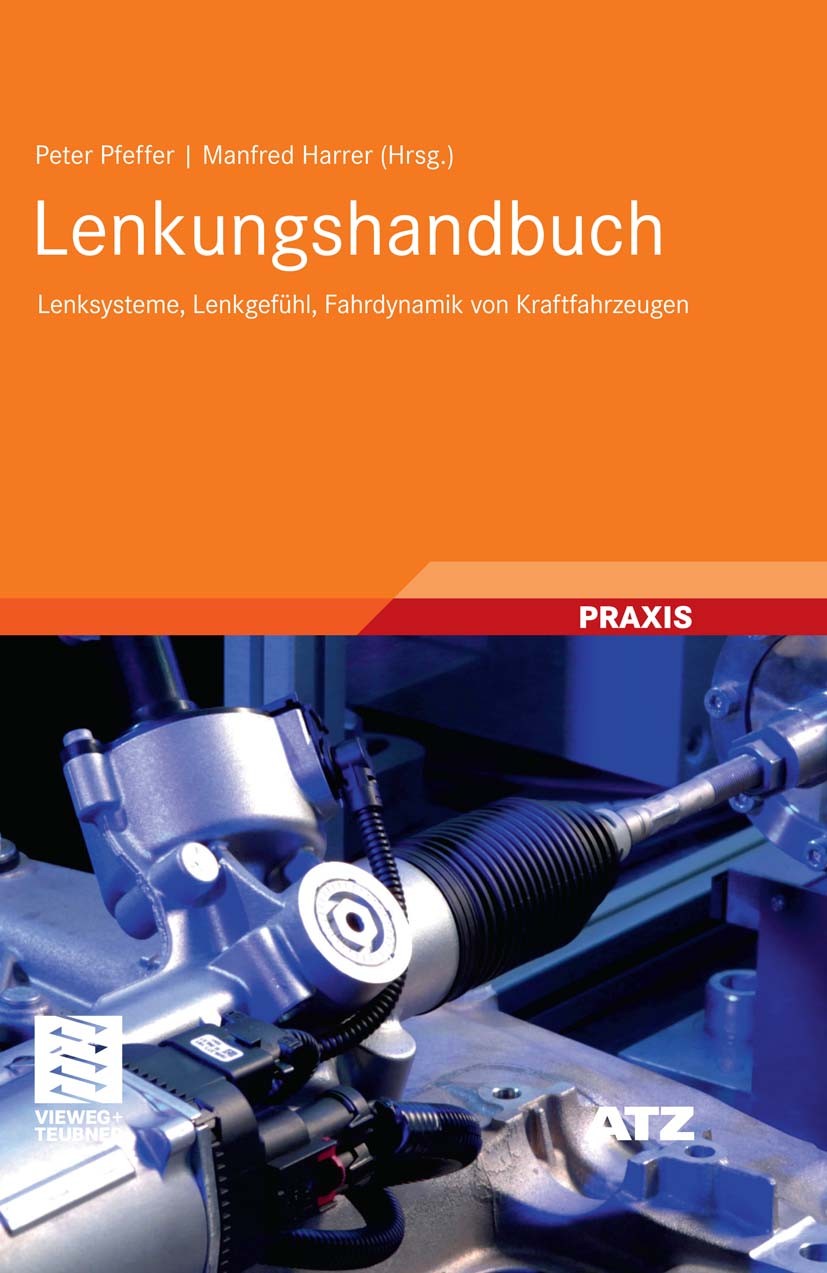 |
| 描述 | Das Lenkungshandbuch deckt alle Bereiche der modernen Lenksystemtechnik im Pkw ab. Es behandelt umfassend die Komponenten, die technischen Konzepte und die Funktionalitäten von Lenksystemen. Schwerpunkt des Buches ist die praxisnahe Darstellung der Grundlagen sowie des aktuellen Standes der Technik. Die Wechselwirkungen Lenkung - Fahrzeug und die daraus resultierenden Anforderungen für die Lenkungsentwicklung werden angezeigt. Der Einfluss der Lenkung auf das Fahrzeughandling und auf das Lenkgefühl wird umfassend dargestellt. ...Der Inhalt.Anforderungen – Geschichtliche Entwicklung – Lenkkinematik – Fahrdynamische Grundlagen – Akustik und Schwingungen – Lenkverhalten und Lenkgefühl – Lenksystemtechnologien – Mechanische Lenksysteme – Zahnstangenlenkung – Spurstangen – Kugelumlauflenkungen – Hydraulische Lenksysteme – Hydraulische Energieversorgung – Elektromechanische Lenksysteme EPS– Lenkmomentsensorik – Lenkwinkelsensorik – Steuergeräte – EPS-Regelung – Systemsicherheit – Überlagerungslenkung – Steer-by-wire – Allradlenkungen – Lenksäule – Lenkrad – Fahrerassistenz – Ausblick...Die Zielgruppen.Ingenieure und Techniker in der Konzeption, Konstruktion, Entwicklung, Erprobung, Herst |
| 出版日期 | Book 20111st edition |
| 关键词 | Allradlenkungen; Boardnetz; EPS-Baugruppen; EPS-Regelung; Entwicklungsanforderung; Fahrerassistenz; Highle |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8167-0 |
| isbn_ebook | 978-3-8348-8167-0Series ISSN 2628-104X Series E-ISSN 2628-1058 |
| issn_series | 2628-104X |
| copyright | Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden Gmb |
 |Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-19 10:32
|Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-19 10:32