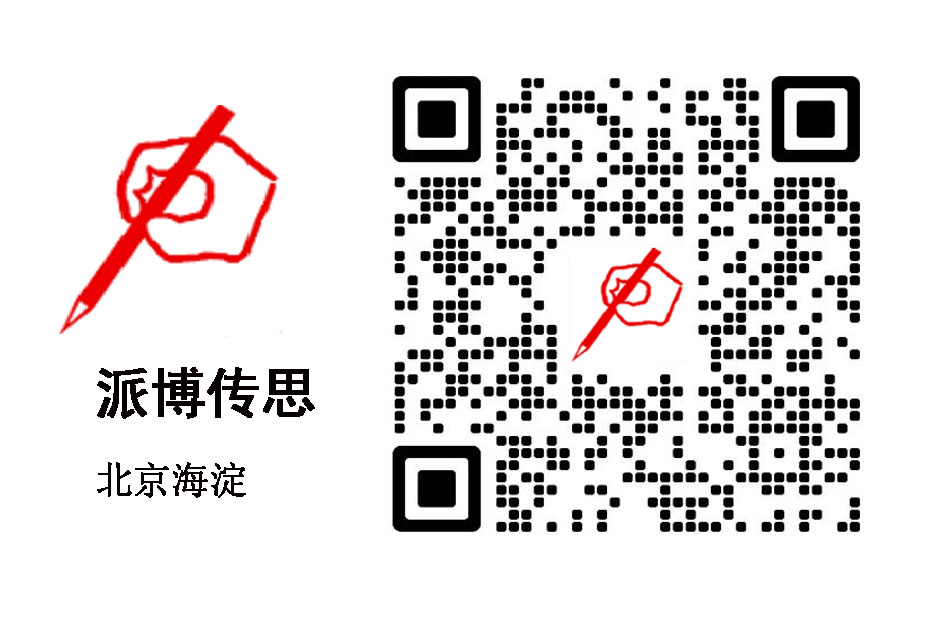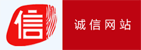| 书目名称 | Strukturelle Faktoren des Bildungserfolgs |
| 副标题 | Wie das Bildungssyst |
| 编辑 | Florian Keller |
| 视频video | http://file.papertrans.cn/881/880458/880458.mp4 |
| 概述 | Sozialwissenschaftliche Studie.Includes supplementary material: |
| 图书封面 | 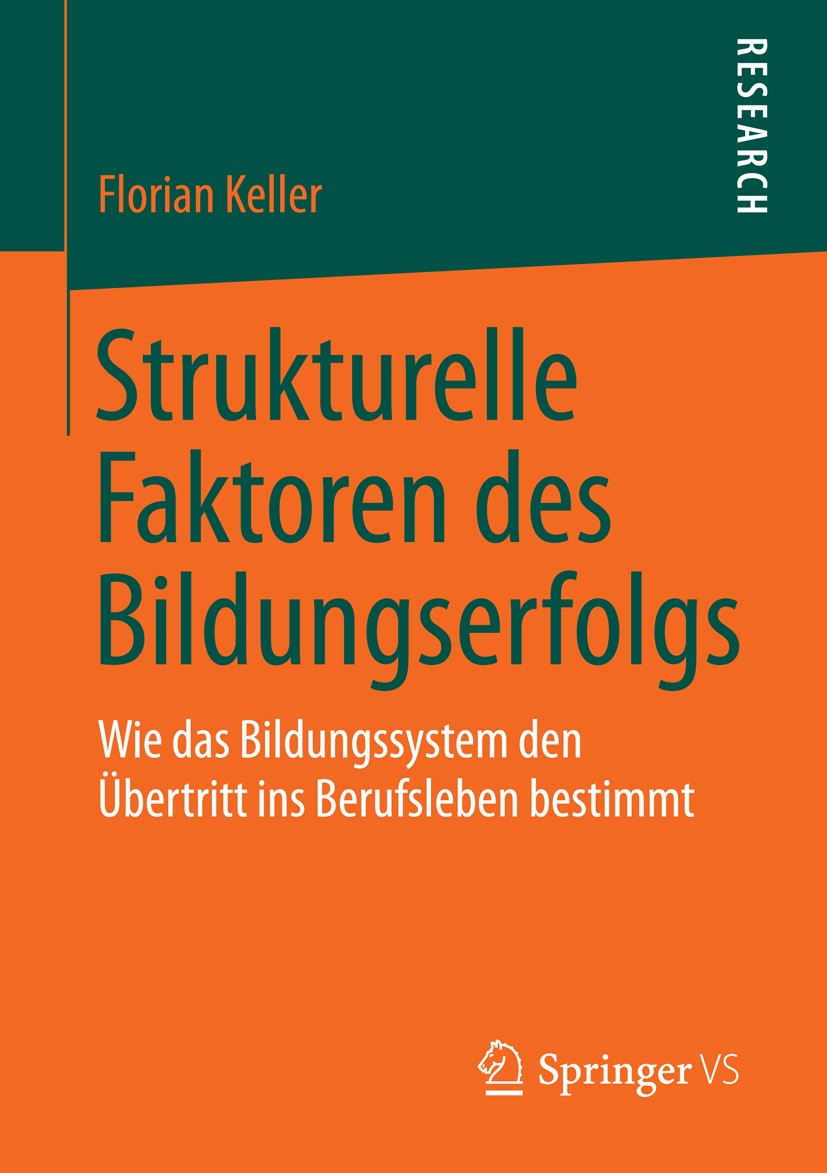 |
| 描述 | An der Schnittstelle zwischen Bildungssystem und ökonomischem System werden die Weichen über zukünftige Berufsbiografie und Lebenschancen gestellt. Der Übergang ins Berufsleben ist deshalb eine entscheidende Phase in der Biografie eines Jugendlichen. Wie dieser Übergang verläuft, hängt stark von individuellen Merkmalen ab. Doch individuelle Faktoren allein genügen nicht für eine Erklärung des Transitionserfolgs. Die möglichen Bildungswege sind auch durch die Struktur des Bildungssystems und des Arbeitsmarkts vorgegeben. Auf der Grundlage von Daten von über 30.000 Jugendlichen analysiert Florian Keller einerseits, welche Faktoren den Eintritt in eine Ausbildung der Sekundarstufe II erleichtern, und andererseits, welche Faktoren den erfolgreichen Abschluss einer zertifizierenden Ausbildung begünstigen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Übertrittschancen maßgeblich von Arbeitsmarkt und Bildungssystem beeinflusst werden. |
| 出版日期 | Book 2014 |
| 关键词 | Arbeitsmarkt; Bildungssystem; Schweiz; Transition; childhood studies |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-05442-7 |
| isbn_softcover | 978-3-658-05441-0 |
| isbn_ebook | 978-3-658-05442-7 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2014 |
 |Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2025-12-14 18:40
|Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2025-12-14 18:40