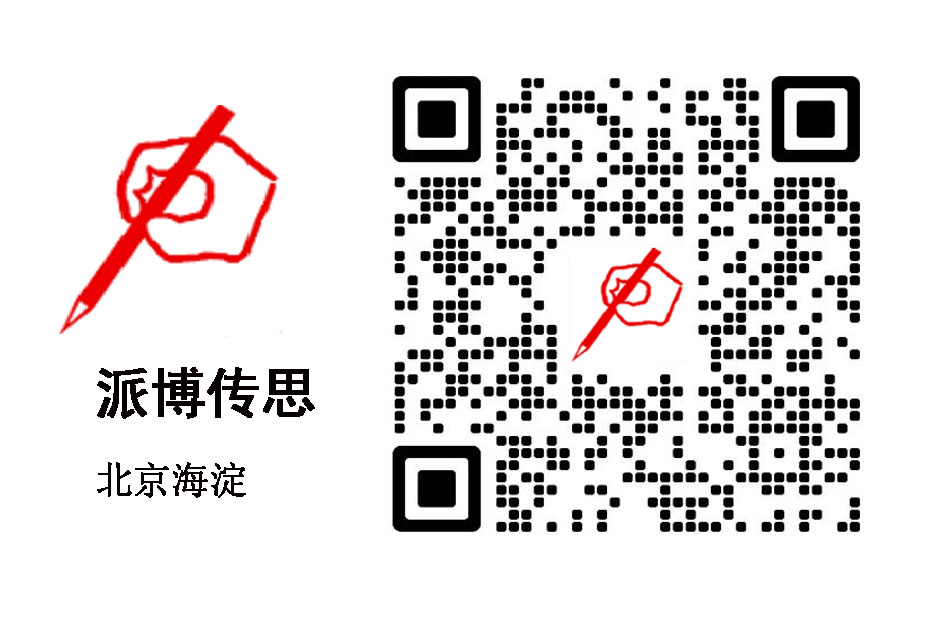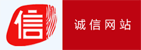| 书目名称 | Das Populäre als Kunst? | | 副标题 | Fragen der Form, Wer | | 编辑 | Thomas Hecken | | 视频video | http://file.papertrans.cn/262/261564/261564.mp4 | | 概述 | Kartierung der Argumente um high brow vs. low brow.Gründe gegen den Ausschluss des Populären aus dem Bereich der Kunst.Mit Beispielen aus Literatur, Musik, Film, Fotografie, bildender Kunst und Design | | 图书封面 | 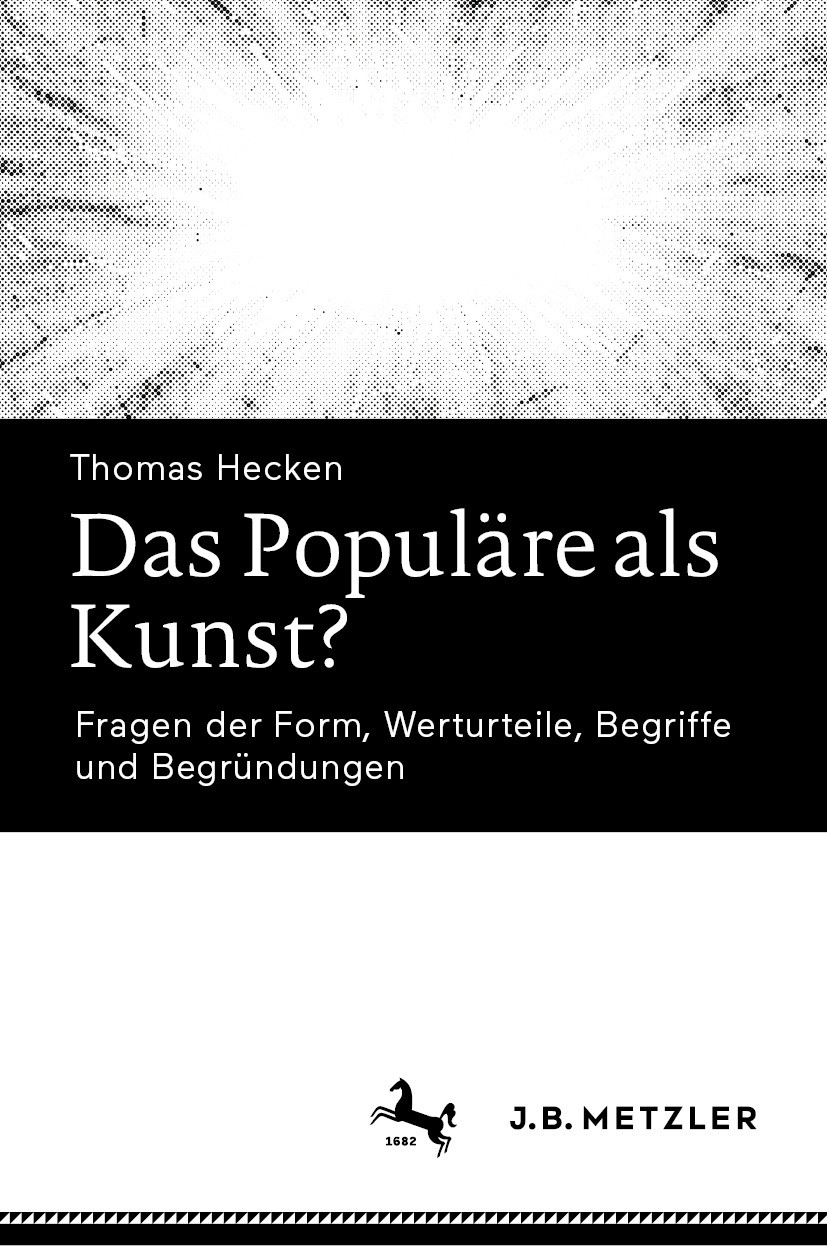 | | 描述 | . .Populären Werken wird seit Jahrhunderten der Status des Kunstwerks aberkannt, unter Verweis auf deren vermeintliche Oberflächlichkeit, Eindimensionalität, Effekthascherei und Standardisierung werden sie streng von ‚echter‘ Kunst geschieden. Schiller, Nietzsche, Adorno, Greenberg, unzählige Kritiker und Feuilletonisten in Westeuropa und den USA – sie alle eint ein starker Vorbehalt gegenüber dem, was von den Vielen anerkannt, geschätzt und gekauft wird. Seit Beginn des 18. Jahrhunderts und besonders seit den 1950er Jahren gibt es aber auch eine Reihe von Argumenten gegen die Auffassung, dass nichts Kunst sei, was auf große Zustimmung trifft. Die Fülle an unterschiedlichen Positionen, Aussagen und Argumentationsmöglichkeiten aufzuzeigen, zu bündeln, zu systematisieren und zu überprüfen, die dem Populären zu künstlerischer Anerkennung verhelfen wollen, ist Zweck dieses Buches. Das Resultat ist eine umfassende Darstellung von Gründen, auch populäre Werke aus Literatur, Musik, Film,Fotografie, bildender Kunst und Design als genuine Kunstwerke betrachten zu können.. | | 出版日期 | Book 20241st edition | | 关键词 | Popkultur; Populäre Kulturen; Populärkultur; Ästhetik; Massenware; Definition von Kunst; Kunsttheorie; Star | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-67981-4 | | isbn_ebook | 978-3-662-67981-4 | | copyright | Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Tei |
The information of publication is updating

|
|
 |Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-2 05:52
|Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-2 05:52