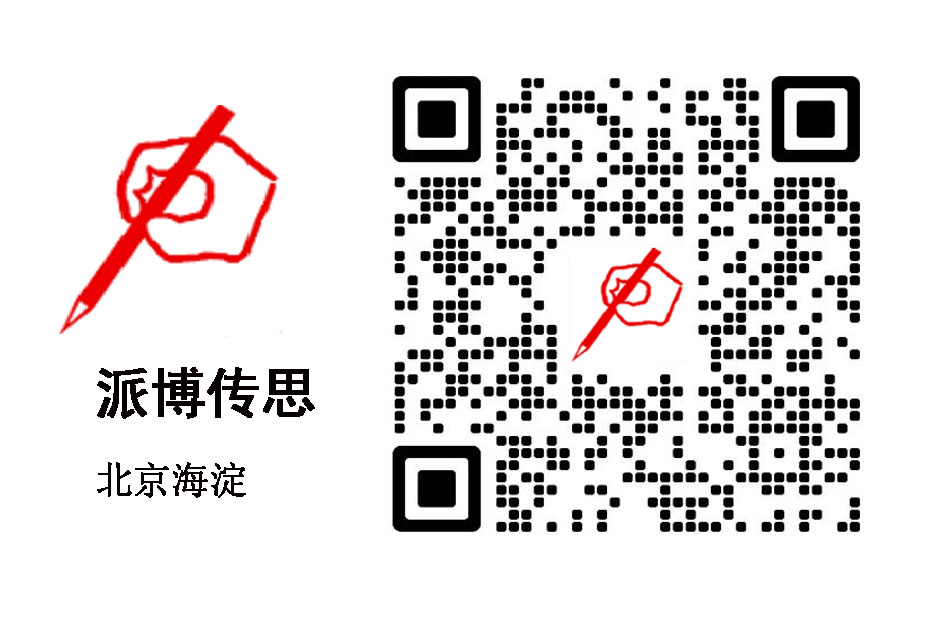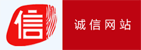| 书目名称 | Universität und Lebenswelt |
| 副标题 | Festschrift für Hein |
| 编辑 | Wieland Jäger,Rainer Schützeichel |
| 视频video | http://file.papertrans.cn/943/942319/942319.mp4 |
| 概述 | Grundlagenbuch zum Wissenschaftsverständnis |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Universitäten sind gegenwärtig einem Sog von Reformen und enormen Belastungen ausgesetzt, die ihre Lebenswelt, aber auch die Beziehungen zu ihrer lebensweltlichen Umwelt stark verändern. Die Beiträge in diesem Band gehen diesen Veränderungsprozessen nach. Sie thematisieren epistemologische wie organisatorische Fragen, befassen sich mit Autobiographien und Identitäten, analysieren die neuen Studienmodelle und untersuchen die lebensweltliche Verortung von Universitäten.. |
| 出版日期 | Book 2008 |
| 关键词 | Alltag; Autobiographie; Identitäten; Lebenswelt; Umwelt; Wissenschaftstheorie |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-531-91077-2 |
| isbn_softcover | 978-3-531-15713-9 |
| isbn_ebook | 978-3-531-91077-2 |
| copyright | VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2008 |
 |Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-19 07:24
|Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-19 07:24