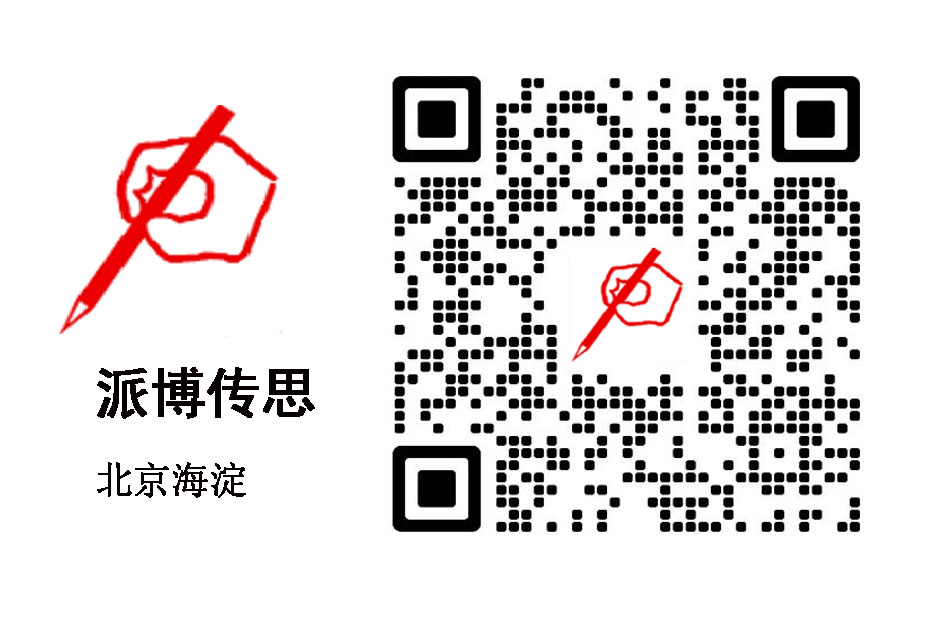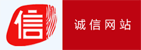| 书目名称 | Regieren in der Einwanderungsgesellschaft |
| 副标题 | Impulse zur Integrat |
| 编辑 | Christoph Bieber,Andreas Blätte,Niko Switek |
| 视频video | http://file.papertrans.cn/826/825190/825190.mp4 |
| 概述 | Aktuelle Beiträge zur Debatte um Flucht, Migration und Einwanderung.Kurze, prägnante Analysen bzw. Essays.Vereint unterschiedliche Perspektiven zum Thema.Includes supplementary material: |
| 丛书名称 | Studien der NRW School of Governance |
| 图书封面 | 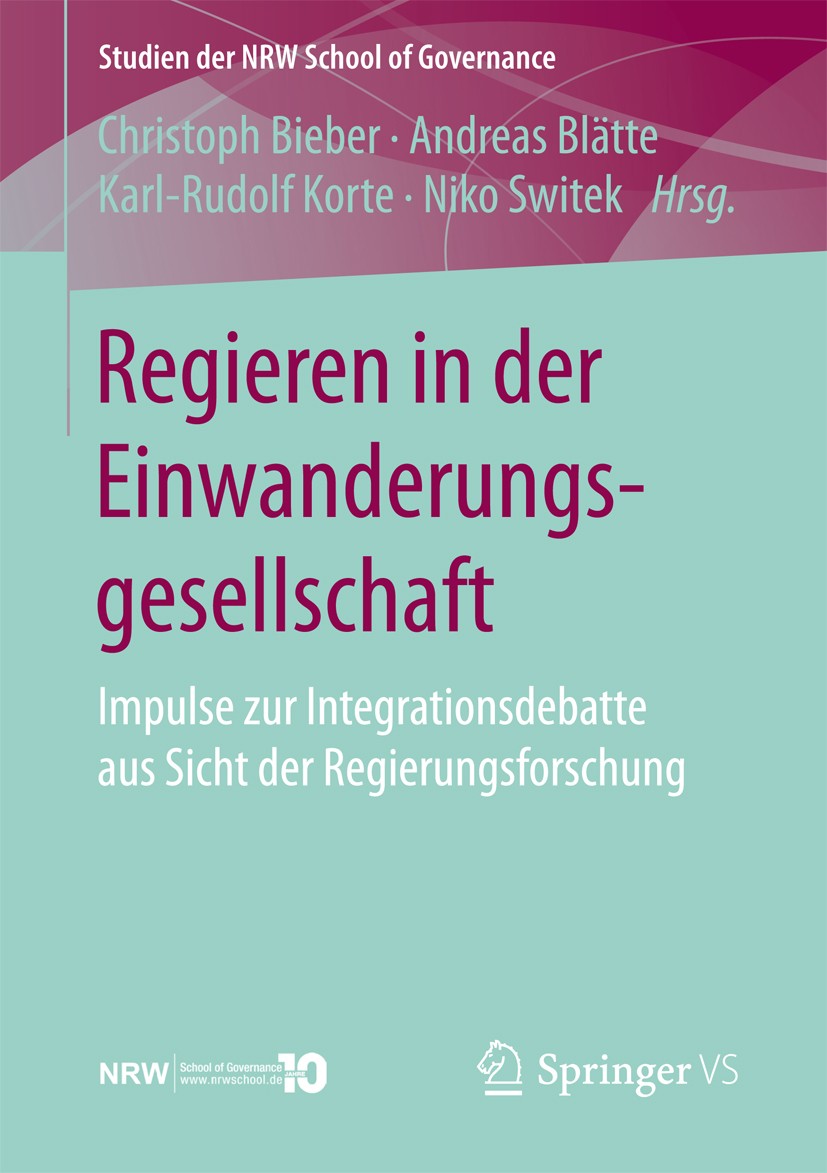 |
| 描述 | Dieses Buch thematisiert die Herausforderung, mit der sich die Politik in Deutschland nach der Aufnahme einer historisch hohen Zahl von Flüchtlingen und in der Folge mit der Frage der Integration dieser Menschen in die Gesellschaft konfrontiert sieht. Die Rahmenbedingungen und Charakteristika des Regierens in der Einwanderungsgesellschaft werden entlang der fünf Themenfelder Politikmanagement, Parteien und Willensbildung, Wahlen und Wählen, wissenschaftliche Politikberatung und politische Bildung sowie Sprache und politische Kommunikation mit verschiedenen disziplinären Ansätzen diskutiert. Die Impulse mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln schärfen das Verständnis für die anstehenden Herausforderung und skizzieren mögliche Lösungsansätze.. |
| 出版日期 | Book 2017 |
| 关键词 | Integration; Parteien; Parteiensystem; Wahlen; Kommunikation; Politikmanagement; Willensbildung; Wahlkampf; |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-15714-2 |
| isbn_softcover | 978-3-658-15713-5 |
| isbn_ebook | 978-3-658-15714-2Series ISSN 2626-2843 Series E-ISSN 2626-2851 |
| issn_series | 2626-2843 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017 |
 |Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-25 03:42
|Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-25 03:42