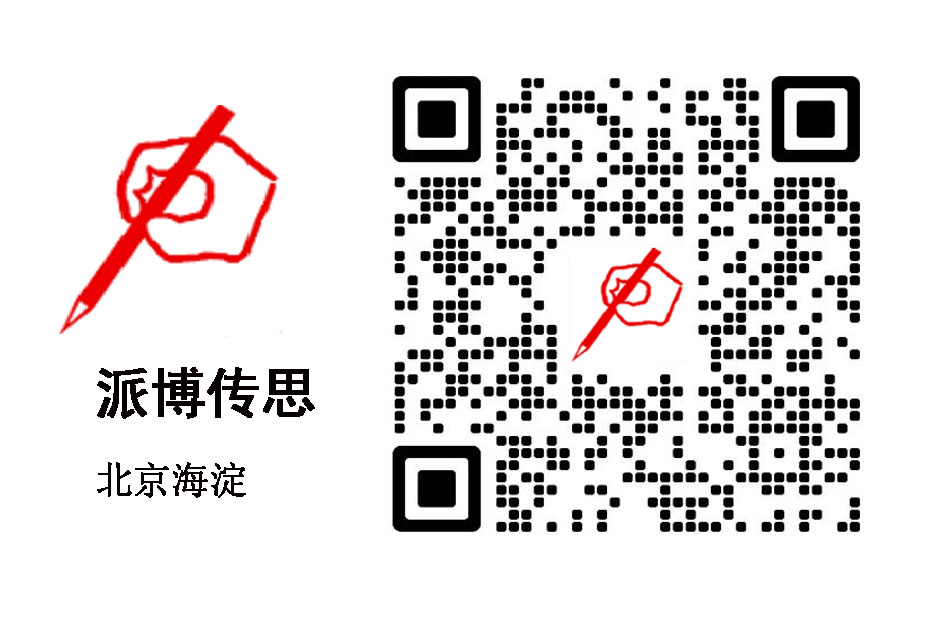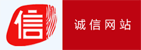| 书目名称 | Rationale Phytotherapie |
| 副标题 | Ratgeber für die ärz |
| 编辑 | Volker Schulz,Rudolf Hänsel |
| 视频video | http://file.papertrans.cn/822/821470/821470.mp4 |
| 概述 | Komplett überarbeitete Neuauflage.Topaktuell: alle wichtigen Phytopräparate.Klarer Aufbau: absolut praxisgerecht für den Arzt und Apotheker.Verläßliche Bewertungen der Phytopräparate |
| 图书封面 | 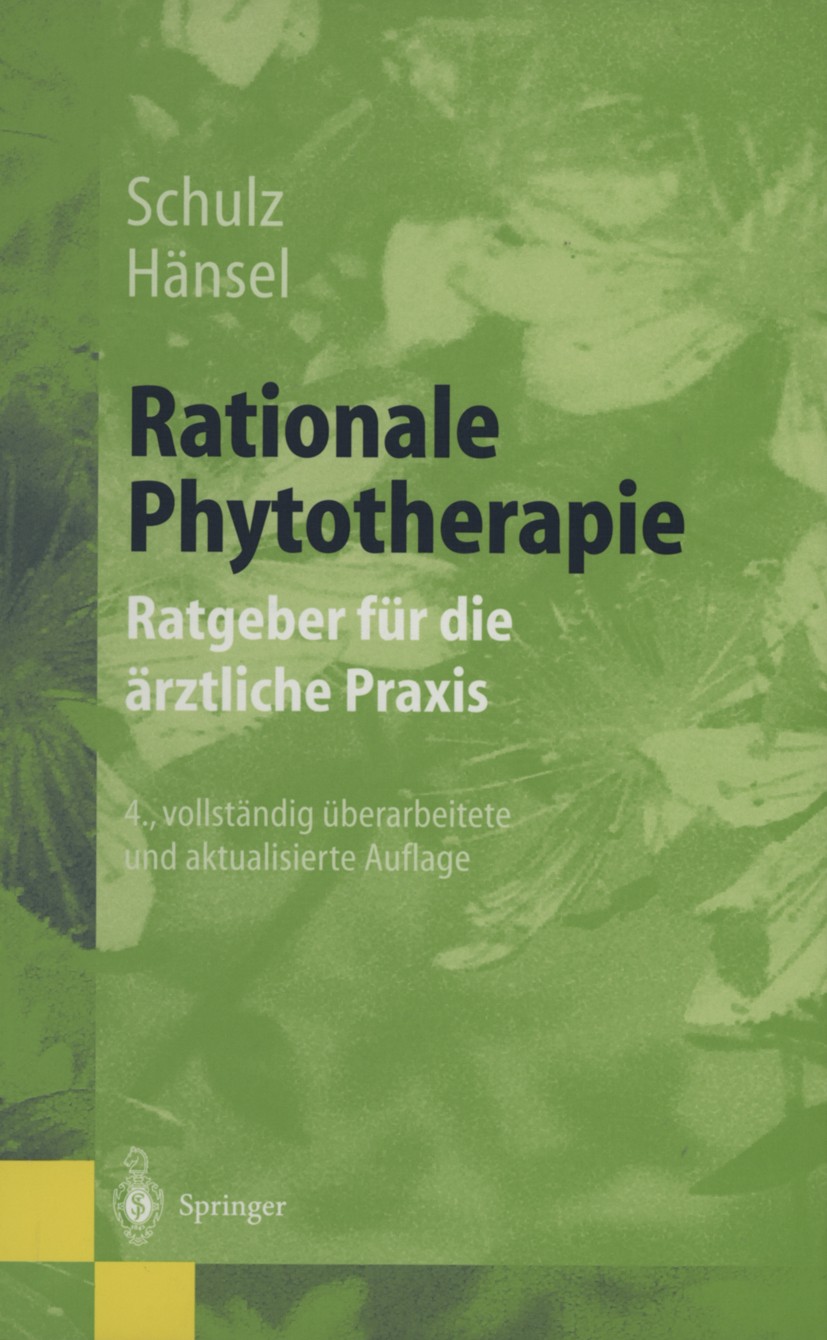 |
| 描述 | Die vorliegende Neuauflage dieses bewährten Standardwerks ist vollständig überarbeitet und aktualisiert. Sie enthält knappe und übersichtliche Informationen zu den neuesten Phytotherapeutika und ist gleichzeitig eine kompetente Einführung in die Prinzipien der rationalen Therapie mit Arzneidrogen. Dieses Buch darf in keiner Praxis und Apotheke fehlen. |
| 出版日期 | Book 19994th edition |
| 关键词 | Arzneidrogen; Arzneipflanzen; Drogen; Heilpflanzen; Komplementärmedizin; Medizin; Naturheilverfahren; Pharm |
| 版次 | 4 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-98032-9 |
| isbn_ebook | 978-3-642-98032-9 |
| copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999 |
 |Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2025-12-18 12:20
|Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2025-12-18 12:20