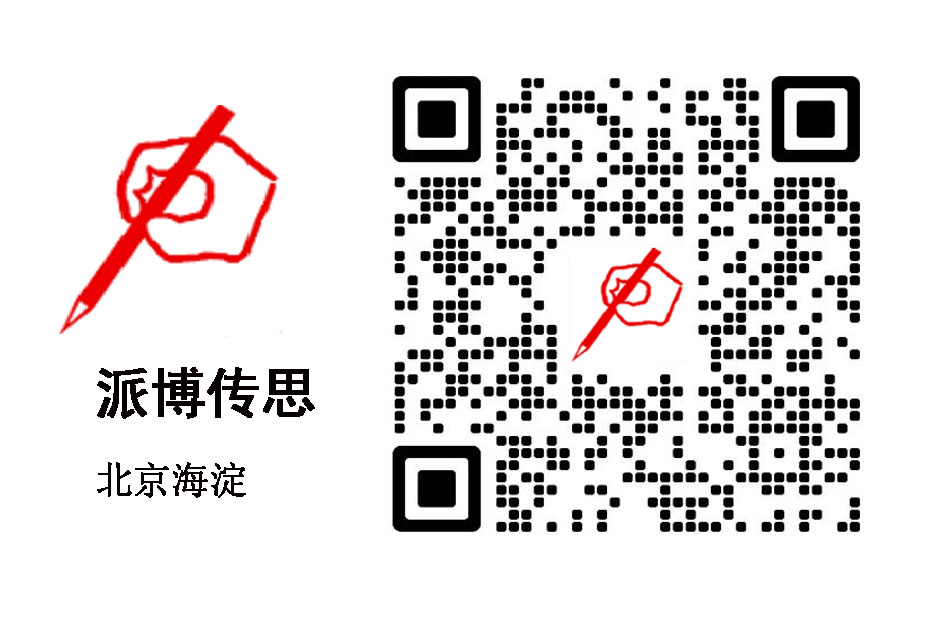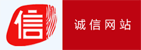| 书目名称 | Frauen "unter sich" | | 副标题 | Eine Untersuchung üb | | 编辑 | Renate Liebold | | 视频video | http://file.papertrans.cn/348/347873/347873.mp4 | | 概述 | Eine Untersuchung über weibliche Gemeinschaften im Milieuvergleich | | 图书封面 | 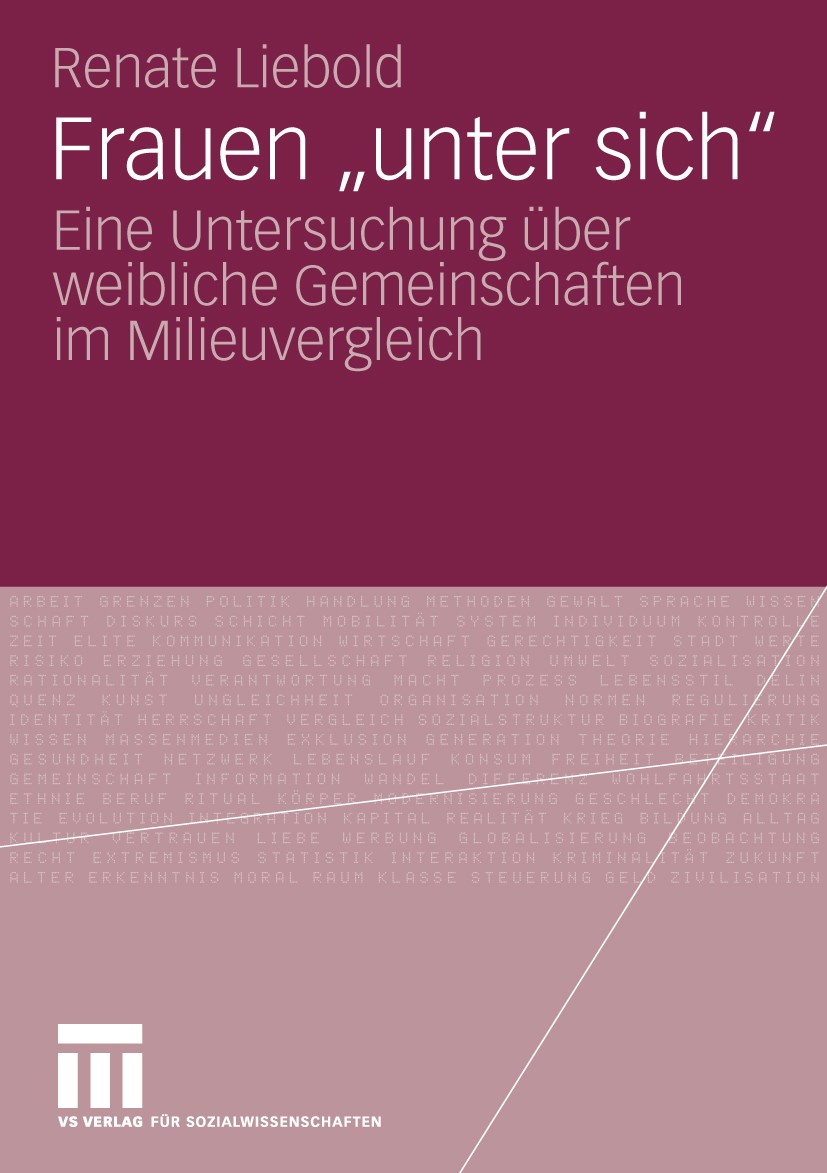 | | 描述 | Wie funktionieren weibliche Gemeinschaften? Welche Rolle spielt Geschlechtlichkeit für die kollektiven Selbstvorstellungen und -darstellungen sowie die Mikropolitiken, die diese weiblichen Gemeinschaften tragen? Diesen Fragen geht die vorliegende Untersuchung in einer wissenssoziologischen Perspektive nach. Gerade dann, wenn Frauen in Vereinen, Selbsthilfegruppen, Netzwerken oder exklusiven Clubs „unter sich“ sind, spielt das Geschlechterverhältnis eine zentrale identitätsstiftende Rolle. In der vergleichenden Untersuchung zeigt sich, dass diese vergeschlechtlichten Ordnungsvorstellungen wesentlich durch das Herkunftsmilieu der Frauen mitbestimmt werden, etwa in Form eher pragmatischer Grenzziehungen bei den Arbeiterinnen und einfachen Angestellten, als zwar reflektierte gleichwohl aber fundamentale Identitätsunterstellung im akademischen Bildungsmilieu oder als elitäres Selbstverständnis bei den Club-Frauen, die das Milieu der gehobenen Gesellschaftsschicht repräsentieren. Damit wird deutlich, dass Deutungsrepertoires von Geschlecht auch über geschlechtsexklusive Räume kulturell festgeschrieben werden. | | 出版日期 | Book 2009 | | 关键词 | Bildungsmilieu; Gender; Geschlecht; Gruppen; Identität; Milieu; Qualitative Methoden; Solidarität | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-531-91685-9 | | isbn_softcover | 978-3-531-16883-8 | | isbn_ebook | 978-3-531-91685-9 | | copyright | VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2009 |
The information of publication is updating

|
|
 |Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-2 01:21
|Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-2 01:21