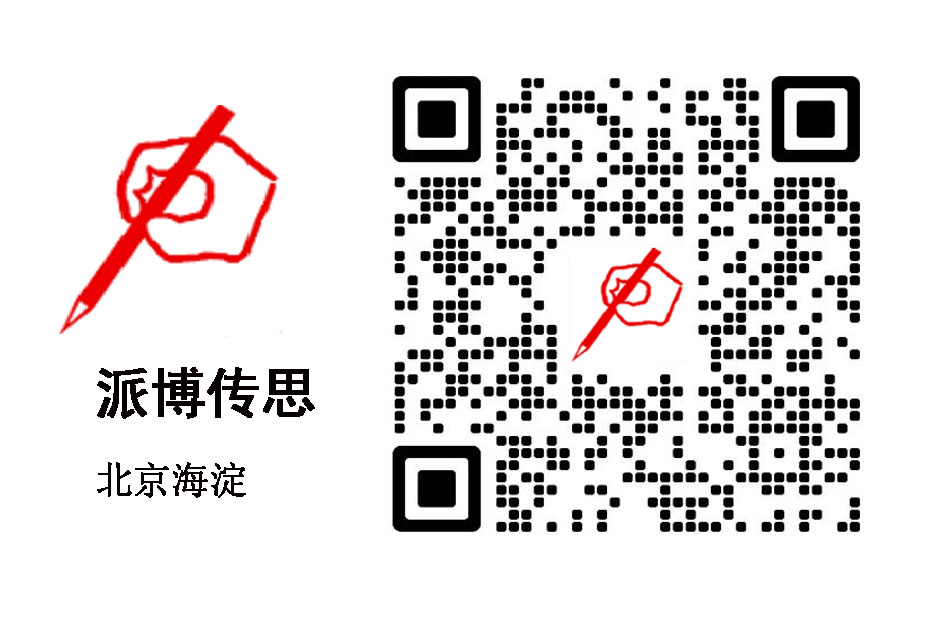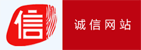| 书目名称 | Chronistin und Kritikerin der Moderne |
| 副标题 | Zum Werk Gabriele Te |
| 编辑 | Luisa Banki,Juliane Sucker |
| 视频video | http://file.papertrans.cn/243/242121/242121.mp4 |
| 概述 | Mit den Exil-Schriften und den Schriften aus dem Nachlass.Feuilletons und Gerichtsreportagen im Fokus.Erster, umfassender Überblick über Gabriele Tergits Werk |
| 丛书名称 | Exil-Kulturen |
| 图书封面 | 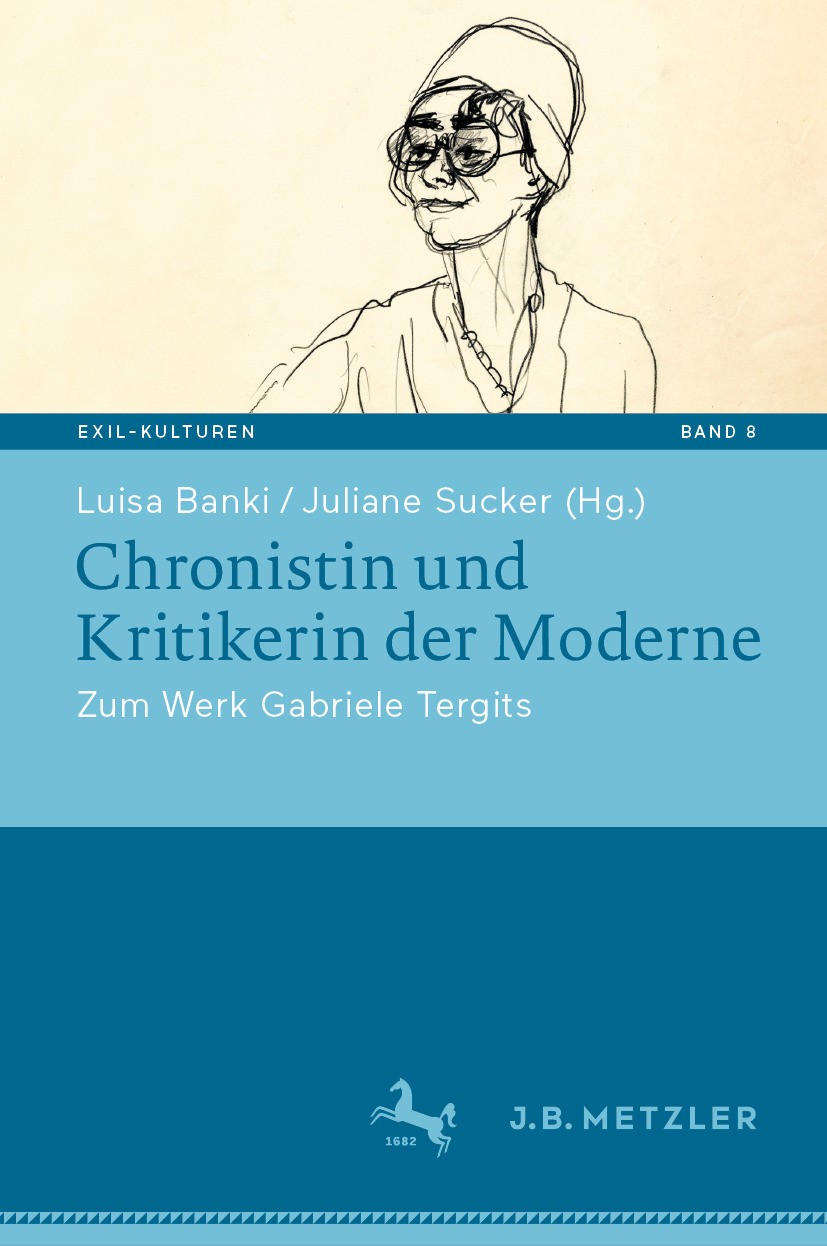 |
| 描述 | .Gabriele Tergit (1894–1982) war bis 1933 eine der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation. Aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen, fand sie jedoch im Exil kein Publikum mehr – obwohl sie kontinuierlich schrieb. Ihr vielseitiges literarisches und publizistisches Schaffen ist bis heute nur wenig bekannt und wissenschaftlich bearbeitet. Der vorliegende Band schließt an die in den letzten Jahren erfolgte ‚Wiederentdeckung‘ Tergits durch Neuauflagen und Nachlasseditionen an und dokumentiert die erste wissenschaftliche Tagung zu Tergits Schreiben. .Bei einem geteilten Interesse an Tergits chronistischem und kritischem Erzählen rücken die einzelnen Beiträge ganz unterschiedliche Werke und Werkgruppen aus verschiedenen Lebens- und Schaffensphasen in den Blick. Neben Reportagen und Feuilletons aus den Jahren der Weimarer Republik, den Romanen, ihren Entstehungsbedingungen und ihrer oft schwierigen Rezeption, werden bisher weitgehend unbekannte, zu großen Teilen unveröffentlichte Texte aus dem Exil und der Nachkriegszeit diskutiert und Tergits Selbstpositionierung als Exilautorin sowie ihre oft auch konflikthaften Bezüge zum zeitgenössischen Literaturbetrieb analysiert.. |
| 出版日期 | Book 2024 |
| 关键词 | Moderne; Generationenroman; Nachlass; jüdische Literatur; Weimarer Republik; Neue Sachlichkeit; Archiv; Lit |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-68811-3 |
| isbn_ebook | 978-3-662-68811-3Series ISSN 2662-1851 Series E-ISSN 2662-186X |
| issn_series | 2662-1851 |
| copyright | Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Tei |
 |Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-21 14:33
|Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-1-21 14:33