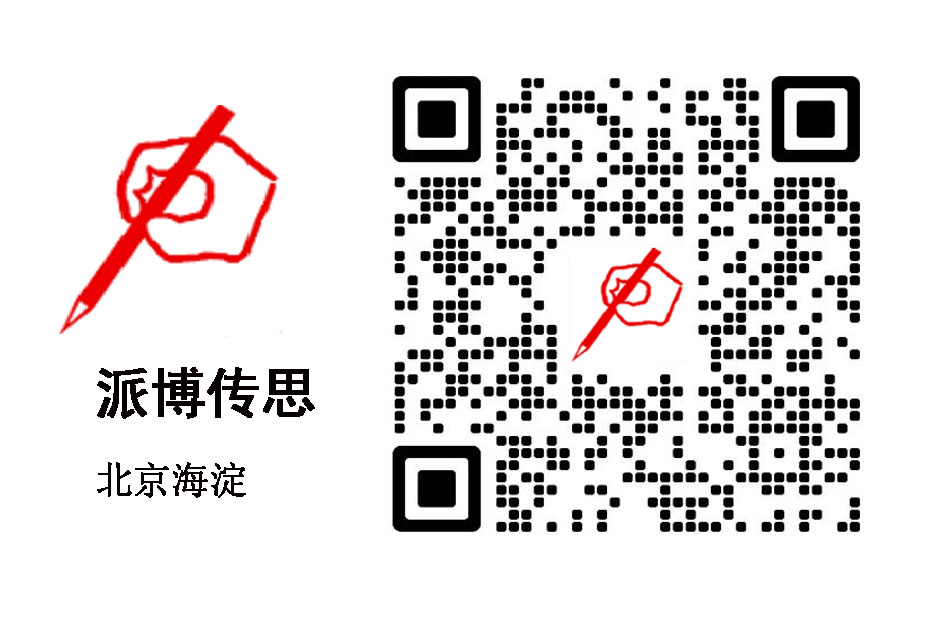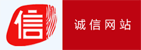| 期刊全称 | „jetzt kommen andre Zeiten angerückt“ | | 期刊简称 | Schriftstellerinnen | | 影响因子2023 | Martina Wernli | | 视频video | http://file.papertrans.cn/103/102962/102962.mp4 | | 发行地址 | Der Auftaktband der neuen Reihe „Neue Romantikforschung“.Neue Perspektiven zum weiblichen Schreiben in der Romantik.Mit Studien u.a. zu Bettine von Arnim, Sophie Mereau, Benedikte Naubert, Johanna und | | 学科分类 | Neue Romantikforschung | | 图书封面 | 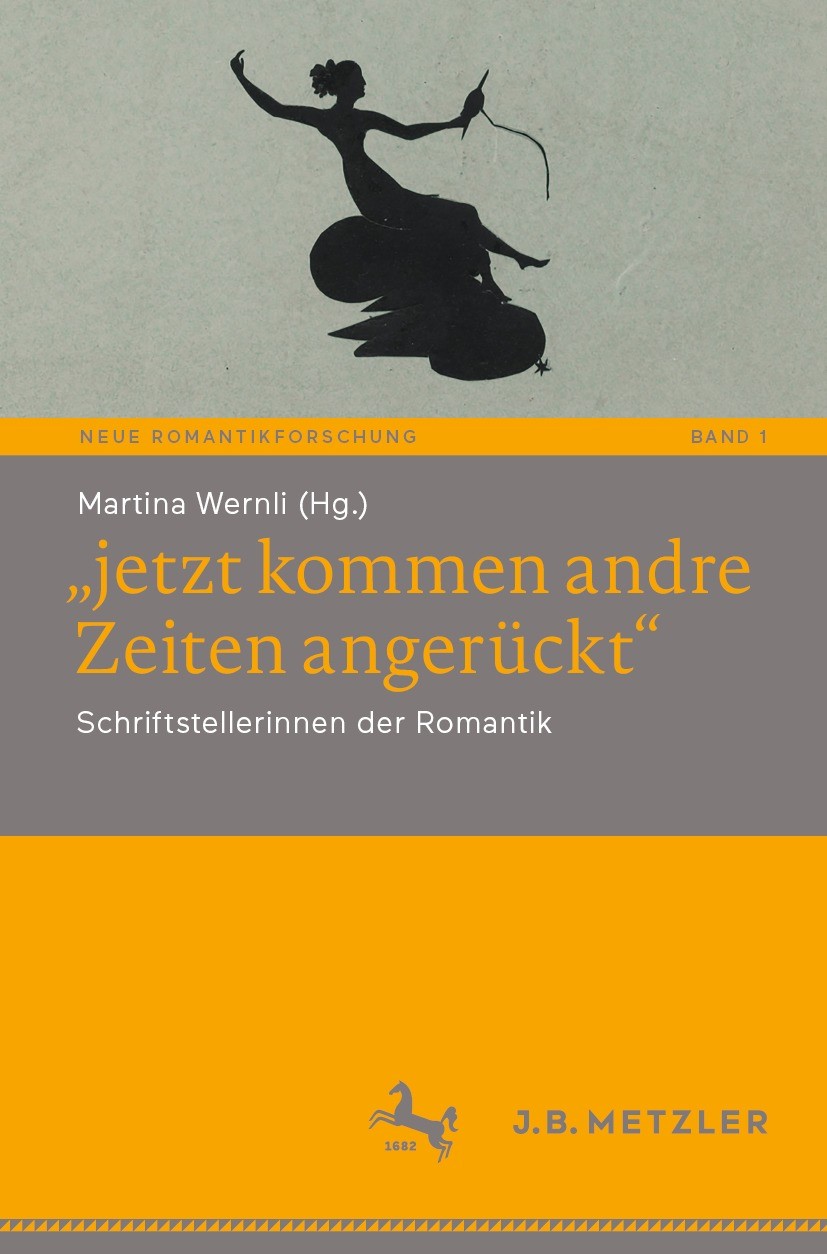 | | 影响因子 | .Sie schrieben Romane, Erzählungen und Gedichte, sie übersetzten, pflegten umfangreichreiche Briefwechsel und verfassten philosophische Aphorismen: die Schriftstellerinnen der Romantik. Diese Aufsatzsammlung führt die Bestrebungen fort, die Werke der Romantikerinnen neu zu lesen. Wiederzuentdecken gibt es in diesem Band u.a. Benedikte Naubert, Dorothea Veit/Schlegel, Henriette Herz, Johanna Schopenhauer, Helmina von Chézy, Sophie Mereau, Henriette Schubart, Rahel Levin Varnhagen, Caroline de la Motte Fouqué, Jane Austen, Königin Luise, Bettina von Arnim, Adele Schopenhauer, Therese von Jakob-Robinson sowie Dorothea Tieck.. | | Pindex | Book 2022 |
The information of publication is updating

|
|
 |Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-2-7 12:50
|Archiver|手机版|小黑屋|
派博传思国际
( 京公网安备110108008328)
GMT+8, 2026-2-7 12:50